
Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich bis Ende 2021 mehr als sechs Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt – nicht selten auf der Arbeit. Ein klarer Fall für den Unfallversicherungsschutz, der ja schließlich durch die Arbeit ausgelöste Berufskrankheiten oder Arbeitsunfälle abdeckt? Nicht unbedingt.
Corona als Berufskrankheit
Damit eine Erkrankung als Berufskrankheit bestätigt wird, muss sie in bestimmten Berufen häufiger vorkommen als in anderen. Dafür müssen die betroffenen Berufsgruppen bestimmten Einflüssen in erheblich höherem Maße ausgesetzt sein.
Welche Leiden als Berufskrankheiten infrage kommen, hat die Bundesregierung in einer Berufskrankheiten-Liste klar definiert. Darin findet sich das Erkrankungsbild „Von Mensch zu Mensch übertragbare Infektionskrankheiten“ (BK-Nr. 3101). Zu den besonders gefährdeten Berufsgruppen zählen Beschäftigte im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege, die zum Beispiel in Krankenhäusern oder Altenheimen arbeiten. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Laboratorien mit besonderen Infektionsgefahren zählen dazu. In diesen Berufsgruppen kann also auch eine Corona-Infektion eine Berufskrankheit darstellen. Nur wenige Betriebe dieser Branchen sind allerdings bei der BG ETEM versichert, sodass die BG von vornherein nur wenige Corona-Fälle als Berufskrankheit einstufen kann. Beispiele sind Corona-Infektionen in krankenhäuslichen Außendiensten von Sanitätshäusern oder in betriebsärztlichen Diensten unserer Mitgliedsunternehmen.
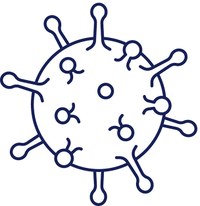
Darauf deuten auch die vergleichsweise niedrigen Zahlen hin: In der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) wurden im Jahr 2021 insgesamt 100.786 Covid-19-Infektionen als Berufskrankheit anerkannt, darunter nur 14 bei der BG ETEM.
Corona als Arbeitsunfall
In anderen Wirtschaftszweigen als im Gesundheitsdienst oder der Wohlfahrtspflege kann eine Covid-19-Erkrankung als Arbeitsunfall gelten. Dies gilt zum Beispiel für Beschäftigte in Büros, in Werkstätten oder auf Baustellen. Voraussetzung ist, dass der Kontakt mit einer sogenannten Indexperson nachweisbar ist.
Das ist zeitgleich auch eine zentrale Herausforderung. Denn meist lassen sich Unfälle bei betrieblicher Tätigkeit eindeutig belegen. Wenn sich zum Beispiel ein Lagerist das Knie prellt, weil er beim Kommissionieren über eine Palette stürzt, steht in der Regel zweifellos fest, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Auch für Beobachter von außen ist klar erkennbar, dass hier wahrscheinlich die Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls erfüllt sind.
Der Nachweis einer Corona-Ansteckung im Betrieb ist dagegen deutlich schwieriger: Diese mag sich mutmaßlich auf der Arbeit zugetragen haben, doch für eine Anerkennung braucht die BG ETEM einen Nachweis darüber, dass ein intensiver Kontakt mit einer infektiösen Person, also der Indexperson, vorgelegen und die Ansteckung verursacht hat. Die bloße Möglichkeit, dass bei der versicherten Tätigkeit Kontakt mit Infizierten bestanden haben kann, reicht nicht aus. Zu berücksichtigen sind auch die individuellen privaten Lebensumstände – also, ob die Infektion sich auch im privaten Bereich ereignet haben könnte.
Zeitintensive Nachforschungen nötig
Für eine Entscheidung ist in jedem Einzelfall eine Abwägung der privaten und beruflichen Infektionsmöglichkeiten erforderlich. Nur wenn die Zweifel an einer betrieblichen Übertragung ausgeräumt sind, kann eine Covid-19-Infektion als Arbeitsunfall anerkannt werden. Zudem kann es sehr zeitintensiv sein, Ansteckungswege zu rekonstruieren, wenn dazu Rückfragen beim Betrieb und teilweise bei Gesundheitsämtern notwendig sind.
So kommt es, dass von den bei der BG ETEM gemeldeten 1.511 Corona-Infektionen im Jahr 2021 etwas weniger als jede vierte als Arbeitsunfall anerkannt wurde. Der Vergleich mit allen Unfallversicherungsträgern zeigt eine ähnliche Quote: 2021 erhielt die GUV insgesamt 25.991 Arbeitsunfallmeldungen mit einer Covid-19-Infektion als Diagnose. 7.665, also etwas mehr als jeden vierten Fall, stuften die Unfallversicherungsträger tatsächlich als Arbeitsunfall ein.
Hannah Schnitzler
So hilft die BG ETEM
Was nach einer Corona-Infektion im Betrieb zu tun ist.
Infektion als Arbeitsunfall anzeigen
Besteht der begründete Verdacht, dass sich ein Mitarbeitender bei der Arbeit mit dem Coronavirus infiziert hat, sollte der Betrieb eine Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltung erstatten. Dort wird jeder Fall einzeln geprüft.
Reha-Programme für Covid-19
Die BG Kliniken haben spezielle Behandlungsangebote für Patienten mit Covid-19 und Post-Covid-Beschwerden entwickelt. Sie werden für jeden Patienten individuell zusammengestellt. Basis ist eine detaillierte Diagnose, der Post-Covid-Check. Der kann bis zu zehn Tage dauern, wird stationär in einer Klinik durchgeführt und schließt neurologische, psychologische und zahlreiche weitere Tests ein. Je nach Ergebnis stehen differenzierte Reha-Verfahren zur Verfügung.
Covid-19 als Berufskrankheit
Wie bei jedem anderen Arbeitsunfall wird Covid-Erkrankten ein persönlicher Reha-Berater oder eine Reha-Beraterin zur Seite gestellt. Die kümmern sich um alles Weitere, koordinieren die Behandlung von der Diagnose bis zur Rehabilitation.
→ info
Neu: etem im Podcast „Ganz sicher“

Bernfried Fleiner berichtet, wie es ihm heute geht und wie er anderen Mut machen will.
Alle Folgen von „Ganz sicher“ gibt es hier: www.bgetem.de, Webcode 15539818
Und auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts sowie Soundcloud.
Diesen Beitrag teilen